NAIROBI-NANYUKI-ISIOLO-MADO GASHE-WAJIR-MANDERA
Montag 1 Juni
Landeanflug am frühen Morgen. Morgenrot über den Wolken. Flug
durch die Wolkendecke, Lichter, Wiesenflächen, Flussmäander.
Moderate Passformalitäten. Visagebühr 24 $, die ich nicht genau
zur Hand habe. Zum Bankschalter, wo die Fluggäste, die bereits alles
erledigt haben, Schlange stehen, Reiseschecks signieren, Banknoten zählen.
Schliesslich unterwegs Richtung Bus. Ein Range Rover Fahrer nimmt uns
mit in die Stadt. Engländer, arbeitet für eine Bank. Er bringt
uns bis zu einem Schmuckgeschäft in der Pundu Str., in dem man angeblich
zu einem günstigeren Kurs als in der Bank wechseln kann. 1 US$ sind
16 Kenya Shilling.
Schleppen unser Gepäck in die River Road und besichtigen eine Lodge
mit Bar. Lodge ohne Bar, das ist vielleicht noch erträglich.
Lodge Nyandarua. Das Zimmer ist längere Zeit schon nicht geputzt
worden. Der Balkon ist verstaubt. Die Fenster sind nahezu undurchsichtig.
Das Bett hat die Eigenschaften eines Trampolins. Wände und Mobilar
wirken abgegriffen und pickig. Und die vielen Gitter. Spätestens
Morgen gleich woanders hinziehen. Besichtige kurz darauf eine andere Unterkunft.
Vierstöckiges Haus, innen neu gestrichen.
Dienstag 02 Juni
Oh what a night. Töpfe werden bis spät in die Nacht gewaschen.
Kochen die Hotelgäste selbst? Türen bis in tiefste Nacht auf
und zu geschlagen. Immer wieder Bewegung im Stiegenhaus, Palaver. Duschen
sind in Betrieb. Dazu der Lärm der River Road, offenbar die Ausfallstrasse
des Busbahnhofes. Kurzzeitig schüttet es wie aus Wannen vom Himmel,
danach ist es etwas ruhiger bis bald darauf wieder unablässig LKW
vorbeirumpeln. Eine Zeit lang schreit auf der Strasse einer Mord und Totschlag,
vielleicht ein Betrunkener. Endlich in tiefster Nacht als es ruhiger wird,
stehen die ersten bereits wieder auf und beginnen zu rumoren. In dem Bett
rollen Franzis und ich zwangsläufig in eine Art Grube. In der River
Road rattert ein Bus nach dem anderen vorbei. Ein Radio wird aufgedreht,
aus den Duschen plätschert es, heftiges Sprudeln in dem im Zimmer
befindlichen Waschbecken. Hört sich an, als ob jemand mit einer Saugglocke
Wasser hereindrücken wolle.
Am frühen Morgen verlassen wir diese Unterkunft und beziehen das
Zimmer im vierten Stock des Hotels, das ich gestern noch besichtigt habe.
Heide und Franzis schlafen am hellen Nachmittag. Das Zimmer ist erst unlängst
ausgemalt worden. Bis in Türhöhe sind die Wände meeresblau
gestrichen. Die Türen auch. Eine führt auf einen kleinen Balkon,
die andere ins Nachbarzimmer, beide sind versperrt. Hoffentlich mietet
niemand dieses Zimmer.
Es ist dicht bewölkt und warm. Ein Propellerflugzeug der army überfliegt
das Stadtviertel. Ausblick unter anderem auch auf die New Kenya Lodge,
boarding and lodging. Wahrscheinlich eine miese Bude mit ewig Krach, da
in der River road gelegen. Wieder fliegt ein Flugzeug der army vorbei.
Man versucht uns auf die Spur zu kommen. Möglicherweise zu oft Moebius'
The Airtight Garage gelesen. Gegenüber befindet sich ein ebenerdiges
Gebäude mit einer dreieckigen roten Fahne, darauf eine Art Neptunsdreizack
genäht ist. Einige wohlgenährte Inderinnen gehen in das Haus.
Die unverputzten Mauern scheinen aus Betonziegeln erbaut zu sein, bei
genauer Betrachtung sehe ich, dass es sich aber um Steinquader handelt.
Suche einen wholesaler auf. Ein Fahrrad kostet 1600 Ksh, ein spezielles
Fahrrad, extra starke Ausführung, grosser Ladekorb, kostet 2800 KSh.
Spazieren zum Bahnhof, vorbei an Hilton und Kenyatta Center zu den Bruchbuden,
wo Tee (Chai) und Maisbrei (Ugali) verkauft wird. Chai immens süss,
jedoch nur halb so teuer wie in der Nähe unserer Lodge, wo er ungesüsst
seviert wird. Beinahe eine Debatte mit Heide, da sie etwas kaufen will.
Farbstifte für Franzis. Früher schon Sonnenbrillen und griechische
Puppen. Wer soll das alles schleppen?
Mittwoch 03 Juni
Früher Morgen. Die Sonne liegt flach am Horizont und scheint durch
einen schmalen Schlitz zwischen zwei Wolkenbänken. Dauert nur kurze
Zeit. Die Stadt ist wie in goldenes Licht getaucht. Die Wolkenkratzer
im Westen sind utopisch beleuchtet.
Spaziere zum Nairobi River, durch den Ngara Market, wo aber um diese Zeit
noch nichts los ist, vorbei an einem steten Strom von Menschen, die alle
ins Zentrum streben. Gehe ein Stück die Park Road stadtauswärts,
dann die Kinshasa Rd bis zur Ring Rd und Racehouse Rd. Frühstück
mit Heide und Franzis in der North West Lodge. Betteln so lange, bis für
uns extra Uji, flüssiges Maisporridge, gekocht wird. Um diese Uhrzeit
ist die Uji Zubereitung schon abgeschlossen.
Besuche das mir empfohlene Geschäft, um Geld zu wechseln. Spreche
mit einer Inderin, die mir in leisem Ton mit einem Seitenblick auf einen
anderen customer zu verstehen gibt, dass ich später kommen soll.
Besuche den Markt und im Anschluss daran wieder das Geschäft. Diesmal
teilt man mir mit, dass kein Interesse besteht, Dollars zu wechseln. Heide
besucht den Markt beim Nairobi River. Ich beobachte zwei jugendliche Akrobaten
in der Latema Str. Umringt von einer Menschenmenge führen sie Handstandüberschläge
in Serie aus. Und das auf Asphalt oder Beton. Gleichzeitig heben sie dabei
etwas vom Boden auf, etwa eine hingeworfene Münze oder sie machen
Überschläge auf einer Hand. In der Stellung Brücke laufen
sie wie Hammel. Auf der Krempe eines Hutes stehend, schwingen sie in den
Handstand, dabei fassen sie den Hut mit den Zehen und plazieren ihn dann
auf dem Kopf. Eine Variante davon ist, spielerisch mit dem Kopf dem Hut
auszuweichen. Schliesslich aber gelingt es dem Fuss, den Hut zu plazieren.
Weitere Kunststücke: Zigarette im Mund, ein Fuss hält das Zündholzschachterl,
der andere das Zündholz. Dann geht der junge Mann in den Handstand,
die Füße zünden vor dem Gesicht die Zigarette an.
Im Sitzen: ein Fuss ist nach vorne gestreckt, einer nach hinten und zwar
derart, dass er als Kopfstütze dient. Ein Knie gebeugt, der Fuß
nach vorne in der Hüfte eingehakt. Verschiedene andere unbeschreibliche
Verknotungen. Dann noch: beide Füße über dem Kopf verschränkt
und gehen auf den Händen. Variation: Füße über den
Schultern verschränkt. Der Körper schwingt dann wie eine Schaukel
zwischen den Armen. Makaber.
Am Nachmittag spazieren wir mit Malik unserem Zimmernachbar durch die
Stadt. Er ist aus Pakistan und arbeitet für eine UNO Organisation
in Mogadishu. Hier besucht er einen Arzt. Wir wandern ausgehungert bis
zu den Restaurant Buden nahe der Kenya Railway Station. Dort gibt es endlich
Ugali, festes Maisporridge, dazu eine Sauce mit Kraut. Auf kleinen Tellern
stets auch winzige Piri Piri, die einem die Schweissperlen aus den Poren
treiben.
Donnerstag 04 Juni
Frühstück in der Kirinyaga Rd. Höhe Latema. Dann zum Ngara
Market am Nairobi River. Dort gibt es Hemden, Socken, Kappen, Werkzeug,
Schlösser, Radioteile, Kunststoffschuhe, Taschen, sowie Orangen,
Tangerinen, Erdäpfel, Mango, Guaven, Bananen, Tomaten, Zwiebel, Mais,
Salat, Karotten, Erbsen.....
Entlang des Nairobi River bis zur Racehouse Rd., wo wir die Restaurantbuden
am Rande einer Barackensiedlung erforschen. Es gibt Erdäpfelpürree
mit Bohnen und Maiskörnern und alles grün gefärbt durch
grosse Blätter eines unbekannten Krautes.
Nachmittag. Wasche Wäsche im Hof unserer Unterkunft Nyandarwa Lodge.
Nahe Latema Street. Komme ins Gespräch mit einem Marungi (Kat) dealer
aus Meru, der sich in diesem Hof mit Wasser erfrischt. Unterhalten uns
übers Wäsche waschen, den österreichischen Präsidenten
und ehemaligen UNO Sekretär, bis hin zur Ausbildung des Besuchers
in der Royal Airforce in England, seine Reise von dort nach Berlin, einen
Putschversuch der Airforce in Kenya und seinen Aufenthalt in einem Gefängnis
in Mombasa. Sein shop befindet sich im Parterre der He Up New Rwatha Lodge
in der Latema Str.. Boarding and lodging, eine Bar im ersten Stock. Lodging
für Leute die nicht schlafen wollen in der Nacht.
Besuche den Country Bus Terminal. Mindestens ein Schlangenbeschwörer
tritt dort auf. Ziemlicher Verkehr. Der Bus nach Isiolo über Thika,
Embu, Chuka und Meru fährt um 10:30 und kostet 6 KSh. Die Fahrt dauert
angeblich fünf Stunden. Spaziere in der Lagos Rd. zurück. Zahlreiche
Schallplattenverkäufer in den Pawlatschen.
Freitag 05 Juni
09:00 Busabfahrt nach Isiolo. Überlegen, ob wir nicht gleich wieder
aussteigen. Der Fahrer fährt auf einer ausgefransten Asphaltpiste,
als ob es sich um ein Rennen handeln würde. Und entgegen kommen Busse,
die von ebensolchen Fahrern gelenkt werden. Wir sind voll beschäftigt,
bloss um uns festzuhalten. In Nanyuki reicht es schliesslich und wir steigen
aus.
Samstag 06 Juni
Hotel Roskaki in Nanyuki. Trotz des hohen Preises sind die Zimmer sehr
klein. Unnötigerweise sind Dusche, Toilette und ein Waschbecken eingebaut
worden. Entlang des Hotels führt die gerne befahrene Strasse weiter.
Selbst in der Nacht kommen wir in den Genuss dröhnender Motoren und
scheppernder Ladungen von vorbeifahrenden LKW. Möglicherweise wird
der Lärm hier im Schichtbetrieb erzeugt. Die einen fahren mit scheppernden
Ladungen bis in die frühen Morgenstunden, die anderen beginnen damit
schon wieder bevor die einen endlich aus ihren Fahrkabinen fallen. Dazu
kommt noch der unvermeidliche Krach der Bar von vis a vis. Musik, Geschepper
und Geschnatter. Zwischendurch ein Wolkenbruch. Teile des Regenwassers
werden offenbar durch ein Abflussrohr, in das die Dusche einmündet,
abgeleitet. Andauerndes Geplätscher und die Dimension des Rohres
sind ein Indiz dafür. Die Palette der hotelinternen Geräusche
ist im übrigen äusserst farbenfroh. Bettenrücken über
unserem Zimmer oder auch sonstwo. Auf- und Abdrehen von Wasserhähnen,
Betätigung von Klospülungen. Trippeln und Trampeln im Stiegenhaus
und im Korridor. Scheppern von Schlüsseln, Aufsperren und Zuschlagen
von Türen.
Frühstück. Vom Mount Kenya ist nichts zu sehen, bloss Wolken
und Safari Busse. Anscheinend ist hier gerade Regenzeit. Gummistiefel
wären das ideale Schuhwerk. Aufgeweichter Boden, lehmige Erdbatzen
bilden sich an den Schuhrändern und lassen sich überall hin
mittragen. Versuchen per autostop weiterzukommen. Menschenmengen beobachten
uns dabei. Vielleicht weil sie nichts besseres zu tun haben oder aus anderen
Gründen. Ein LKW Fahrer nimmt uns mit. Vorbei an Feldern, die Europäern
gehören, kilometerlang, riesengross, abwechselnd mit Weiden. Zäune
ohne Anfang und ohne Ende, von der allersolidesten Bauart. Pflöcke
in der Stärke schwacher Lichtmasten, Eckpflöcke aus ganzen Baumstämmen
und Abstände, die kurz sind. Gespannt ist Stacheldraht. Mehrreihig.
Beiderseits der Strasse, soweit das Auge reicht. Zwischen Fahrbahn und
Stacheldraht verläuft ein schmaler Korridor, ein Niemandsland. Das
darf offenbar von Einheimischen genutzt werden. Kleine Gärten, schmale
Felder, ein Hirte mit einer Kuh und einer kleinen Ziegenschar. Dahinter
die Herden des Grossgrundbesitzers samt Infrastruktur wie Unterstände,
Tränken. Eine Pferdeherde zur Abwechslung und zahllose Schafe auf
einem glatten Hügel. Ein kleines Flugzeug auf einem Flugfeld innerhalb
der Weiden. Der LKW Fahrer lässt uns an der Kreuzung Isolo - Meru
aussteigen. Dort nimmt uns ein Pick Up Fahrer mit, ein dealer in skins
and hides aus Meru mit jemenitischen Vorfahren. Die Strasse führt
hinunter in die Ebene, wir verlassen das saftige Grün um den Mount
Kenya.
Im Gespräch erfahren wir, dass um 14:00 Uhr das Mira (Kat) in Isiolo
eintrifft. Hier ist es noch ganz frisch, da es noch nicht weit transportiert
worden ist. Es wächst am Fusse des Mount Kenya.
Der Fahrer bringt uns zum Hotel, zuvor deponiert er noch in einem Hinterhof
einen Geldbetrag, business money und behält nur ein Päckchen
Hunderter. Die Lodge verfügt über einen Innenhof, von dem aus
man in die Zimmer geht. Es gibt nur Einzelzimmer. Wir beziehen zwei nebeneinanderliegende
Zimmer. Auffallend die Mosquitonetze über den Betten. Leider voller
Löcher. Hier ist es warm. Franzis rennt im Hof herum, ein Zimmernachbar
bügelt seine Hose mit einem Bügeleisen, das mit Holzkohle befeuert
wird, ein anderer drückt in einem Lavoir seine Wäsche. Heide
sitzt in der Tür und raucht. Wir haben unsere Wäsche aufgehängt,
die wir bereits in Nairobi gewaschen und im Hotel Roskaki in Nanyuki zwischendurch
einmal aufgehängt haben. Bloss trocken ist sie nicht geworden infolge
des ständigen Regens.
Am Marktplatz. Unter den Vordächern von Geschäften bringen vor
allem Frauen die Bündel Mirá unter die Bewohner. Überall
wird gekaut und die Blätter von den Stengeln gezupft. Auch die Stengel
werden abgenagt. Ziegen sind unterwegs und gustieren den Abfall. Eine
Frau vom Turkana tribe, die Zähne ganz grün vom zerkauten Mira,
verkauft uns zwei geschnitzte Puppen. Mit Lederschurz, Drahtschmuck, Halsringen
aus halben Reissverschlüssen und wahrscheinlich Menschenhaar.
Ein Fahrzeug fährt an uns vorbei. Der Fahrer hält. Er ist hier
mit Familie und betreibt ein Projekt. Leider rast hinter ihm ein Lastwagen
der Armee heran und so verabreden wir uns auf morgen.
Ein Toyota mit Aufschrift Relief Goods, rot auf weiss, fällt uns
auf. Erfrage die Destination dieses Fahrzeuges. Mogadishu. Der Mann, der
uns Auskunft gibt, ist der Beifahrer. Er versichert uns, dass wir mitfahren
können.
Am Abend in unserer Unterkunft. Dämmerung, Dunkelheit. Kinderstimmen
in der Umgebung, ein Radioapparat ist eingeschaltet. Es weht eine leichte
Brise. Am Ende des Hofes über dem Tor befindet sich ein Wassertank.
Am Giebel steht geschrieben
Ilani
Tafadhali Usipge
Kelele Kuna Watu
Wamelala
Notice
Keep silence please
Some of our customers are asleep
Ein Wellblechtor auf einer Seite des Innenhofes wird geöffnet. In
den kleinen Hof fahren zwei herrliche Safari Kleinbusse, rumpeln über
die Torschwelle. Heulende Dieselmotoren im ersten Gang. Qualm in dem engen
Hof, dem ursprünglich idyllischen. Das Wellblechtor wird wieder geschlossen,
Autotüren auf und zugemacht. Allmählich tritt wieder Beruhigung
ein. Plötzlich wieder Scheinwerferlicht vor dem Wellblechtor. Der
Vorgang von vorhin wiederholt sich. Die Abfahrt der Fahrzeuge erfolgt
noch vor dem Morgengrauen und klarerweise nicht gemeinsam. Beeindruckend
auch längeres Klopfen an eine Zimmertüre und heftiges Flüstern
eines Namens in den Spalt zwischen Türstock und Zimmertüre.
Nasil, Nasil. Nasil, Nasil. Der angerufene Mann steht aber nicht auf oder
erst nach einer Ewigkeit.
Sonntag 07 Juni
Spazieren zur police barrier um zu erforschen, ob wir dort einen LKW finden,
der uns mitnimmt. Heide und Franzis gehen zurück in die Lodge. Besuche
die dänische Familie, die hier in der Gegend, wo ausschliesslich
Nomaden mit ihren Herden leben, ein landwirtschaftliches Projekt realisiert.
Mithilfe eines Windrades pumpen sie aus Brunnen im ausgetrockneten Flussbett
Wasser in grosse Behälter, von denen sie es in ihre Shambas, Gärten,
leiten. Sie bauen vor allem Sorghum an, ein Getreide, das draught unempfindlicher
ist als Mais. Die Familie betreut auch Waisenkinder und gibt ihnen zu
essen. Ein weiteres Projekt ist das Abrichten von Eseln. Eselgespanne
zum Pflügen. Ein Problem sind die Geschirre. Sie versuchen sie selbst
herzustellen. Doch Leder ist teuer. Die Händler halten es zurück,
weil italienische Geschäftsleute alles aufkaufen.
Montag 08 Juni
In der Fahrerkabine sitzt bereits ein Typ, ein Semi-Uniformierter. Geputzte
Schuhe, gewaschene blue jeans und eine Militär Tarnjacke. Dazu ein
Radio in einem giftgrünen, gehäkelten Deckchen. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt hätte ich auf sämtliche Sitze in der Fahrerkabine
bestehen oder ein anderes Fahrzeug suchen müssen. So aber finde ich
mich plötzlich auf der Ladefläche zwischen Methanol Fässern
und Maschinenteilen, Säcken mit Erdäpfel und Bohnen. Erster
Stop bei der police barrier am Ortsende von Isiolo. Die LKW müssen
noch auf die Eskorte warten. Ungefähr fünf Fahrzeuge fahren
im Konvoi. Die Bewaffneten deshalb, weil man weiss es nicht genau. Überfälle
von Banditen und Rebellen. Sicher ist jedenfalls, dass die Route von einer
Organisation kontrolliert wird, die weltweit ein Monopol aufs Kontrollieren
für sich beansprucht. Fünf weitere Male halten wir an diesen
checkpoints: ein paar Wellblechhütten, eine verbeulte Mineralöltonne,
ein Steinhaufen auf der Strasse und ein Eisenträger mit herausragenden
Stahlstiften, das garantierte Aus für jeden Gummireifen. Dreimal
wird mein Pass verlangt, schon höflich aber mit unverhohlenem Misstrauen.
Wir fahren durch Ebene soweit das Auge reicht. Anfangs gibt es noch buschige
Bäume, die zwar keine Blätter haben, dafür in Unmengen
von biegsamen, bleistiftdicken Ästen enden, aus denen eine weisse
Milch austritt, wenn man sie bricht. Immer wieder queren wir ein ausgetrocknetes
Flussbett, das sich als grünes Band in der Ferne verliert, abgesetzt
vom Grün der Akazien. Im Lauf der Fahrt taucht ein Baumtyp auf, der
grau ist und kein einziges Blatt hat und selbst wenn man ihn umschneiden
will, nicht umfallen kann. Seine Äste sind wie Sperren, spröde
und gefährlich und reichen in einem Halbkkreis wieder bis in Bodennähe.
Er macht den Eindruck eines verdorrten Baumes.
Endlose Ebene. Wir sehen Strausse, Giraffen und Wild mit langen spitzen
Geweihen. An den Bäumen immer viele ausgeblichene Vogelnester, kugel-
oder eiförmig. Dann und wann Nomaden mit kleinen Rinderherden oder
Ziegen. Nahe Modo Gashe bereits Dromedare.



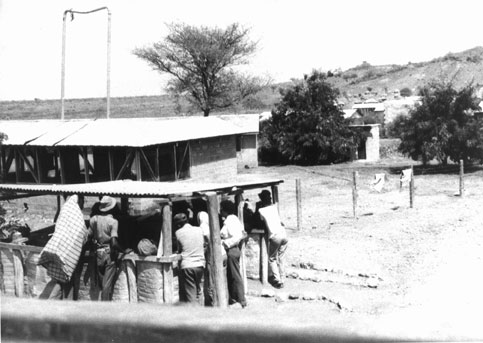







Dienstag 09 Juni
Spaziergang im Ort Modo Gashe. Nicht einfach, weil wir überall sogleich
auffallen. Kommt offenbar selten vor, dass Muzungus, Bleichgesichter,
sich hierher verirren. Jemand fragt mich, ob der LKW mir gehört,
der uns hierher gebracht hat. Immer wieder will auch jemand wissen, woher
wir kommen und warum wir hier reisen. Niemand will glauben, dass wir nur
durchreisen. Hier ist man geschäftlich unterwegs, transportiert irgendetwas
von A nach B oder verfolgt ein Projekt, wie diverse internationale Organisationen
oder die Regierung.
Als Schattenverkäufer wäre man in dieser Gegend in kurzer Zeit
ein angesehener Geschäftsmann.
Abend in unserer Wellblechunterkunft. Einzige Sitzgelegenheit ist der
durchhängende Einsatz des Stahlrohrbettes. Franzis hockt neben mir,
sie ist von der Fahrt etwas angeschlagen, verkühlt vom Fahrtwind
bei extremer Hitze. Ihre Stirn ist heiss, die Nase rinnt und die Stimme
ist heiser.
Heide sitzt auch am Bett und verklebt Briefkuverts, deren Gummierung durch
die Hitze und den Staub ausgehärtet und zerbröselt ist. Am Bett
sind diverse Briefmarken ausgebreitet, Postkarten liegen herum, Banknoten
und Münzen und receipts of the last days, da ich Hose und Hemd eingeweicht
habe. Weiters mein zwei Kilo schweres Toilettetascherl mit Hartgeld aus
Österreich, Trompetenmundstück, unscharfem Rasiermesser, Tuschefläschchen,
Schreibfedern, Verbandsmaterial, Nähzeug in einem Blechdoserl, schwerem
Nagelzwicker, Zahnarztwerkzeug und Dosen mit S/W Film. Unterm Bett liegt
eine Flasche vom letzten Gast. Auf dem Bett eine Schaumstoffmatratze.
Dieses Produkt erfreut sich grosser Beliebtheit. Allein der Anblick aber
genügt, um einem den Schweiss aus den Poren zu treiben.
Das Schreiben auf der Bettstatt ist nicht einfach. Der Arm klebt am Leintuch
und lässt nur ruckartige Bewegung zu. Könnte auch das Buch bewegen
und den Arm festkleben lassen.
Der Himmel ist zumindest dünn bewölkt, was eine Wohltat bedeutet.
Eine Brise weht, dann und wann frischt sie auf und man hört sie in
den Kronen der Bäume im Hof und im Wellblechdach des Zimmers. Franzis
macht die Türe auf und zu und erfreut sich an dem Knarren und Quietschen
der Angeln. Jetzt holt sie das Vorhangschloss und wird uns einsperren.
Zum Brausen des Windes gibt es ein Vogelkonzert, auch ein Hahn kräht
noch um diese Zeit, von der Küche werden Stimmen und die Geräusche
von Tellern und Töpfen herangeweht.
Franzis geht mit den in Isiolo gekauften Puppen in den Hof und murmelt:
Turkana people, Turkana people.
Am Abend stellen wir die Betten ins Freie, um in den Genuss der leichten
Brise zu kommen, die über die Oase streicht. Auf den Bettgestellen
sitzend, unterhalten wir uns in der Dunkelheit unter Sternenhimmel mit
Richard, der aus Kisumu am Victoria See stammt und nach Mandera reist.
Einige Männer, die ihren LandRover in der Nähe ihrer Betten
geparkt haben, kauen längere Zeit schon das unentbehrliche Mirá.
Auf einmal hören wir ein Geräusch, das durch langsam aber bestimmt
austretende Reifenluft verursacht wird. Nach einigen Schrecksekunden oder
vielleicht auch gänzlich unbeeindruckt, beginnen die Männer
mit der Behebung des Schadens. Wagenheber und Werkzeug wird ausgepackt,
Muttern abgeschraubt, der Reifen von der Felge gewuchtet unter Zuhilfenahme
von Hammerschlägen und später wieder aufgepumpt mit Hilfe des
eingebauten Druckluftaggregates, das durch den laufenden Motor angetrieben
wird. In der Nähe unserer Betten.
Schon vor der Morgendämmerung steht die Mannschaft wieder auf, packt
alles zusammen, lässt währenddessen den Motor laufen und fährt
dann ab.

Mittwoch 10 Juni
Stehe auf Grund der Abfahrt von anderen Gästen früh auf. Es
muss hier von Dieben wimmeln, da jeder sein Fahrzeug im Hofe der Unterkunft
abstellt oder überhaupt im oder am Fahrzeug übernachtet.
Ein Traumberuf in dieser Gegend ist Fahrer des Mirá Express zu
sein. Letzterer ist ein Toyota hilux, beladen mit Mirá, dem unabdingbaren
must dieses Landstriches. Die Stengel mit den Blattspitzen werden in Meru
am Fusse des Mount Kenya täglich frisch geerntet, in Säcke verpackt
und verladen. Der Fahrer muss am Abend in Mandera an der somalischen Grenze
ankommen. Laut Richard unserem Informanten ist der Fahrer angewiesen,
mindestens 100 kmh schnell zu fahren, um diese Strecke bewältigen
zu können. Ein LKW braucht mindestens drei Tage für die Strecke.
Um 07:00 Uhr früh braust der Mirá Express bereits durch Modo
Gashe. Sein Herannahen kündet der Fahrer durch kurze Hupsignale an.
Einige Eingeweihte rennen zu einer bestimmten Stelle, der Wagen hält
in einer Staubwolke, die Säcke mit Mirá werden übergeben,
kurzes Palaver und schon drehen sich die Reifen im Sand durch, das Hintergestell
des Wagens schwänzelt hin und her, der Wagen verschwindet in einer
Staubwolke. Wieviele dieser Mirá Express gibt es wohl?
Spaziere zum ausgetrockneten Flussbett. Es ist ziemlich breit und es gibt
einige Gruben, wo unten ein ehemaliges Mineralölfass ohne Boden oder
mit Löchern eingegraben ist, in dem sich Wasser sammelt. Ein Wassertransporteur
schöpft das Wasser mit einer abgeschnittenen Kunststoffflasche mittels
eines Trichters, wiederum eine abgeschnittene Flasche, in einen Behälter,
den er aus der Grube schleppt und auf seinen Eselkarren stellt. Mit dem
Fuhrwerk fährt er zum Hotel. Im Hof befindet sich ein gemauertes
Bassin.
Östlich vom Flussbett befindet sich das Schulareal. Zur Strasse hin
ein headquarter der Kenya Police. Die Strasse nach Garissa zweigt dort
ab. Im Flussbett lagert ein Kamel.
Franziska zieht überall, wo sie auftaucht eine Unmenge Kinder an.
Erwachsene fühlen sich bemüssigt, diese Schar zu zerstreuen.
Die Kinder laufen aber nur ein Stück und kehren dann wieder zurück.
Es ist wieder bewölkt. Angenehm. Die Brise weht auch. Vögel
zwitschern ausgelassen, einige bunt schillernde Exemplare hüpfen
im Hof herum. Halte mich im Restaurant des Hotels auf, um auf einem Tisch
zu schreiben. Durch das Lokal zieht ein Luftstrom und beschäftigt
die Fliegen. Franzis ist auf die Stasse hinausgegangen zu ihrem Freund
Abdi. Im Lokal befinden sich der unvermeidliche Kassier und einige andere
Hotelangehörige. Zwei sind mit Stiefeletten ausgerüstet, der
Rest mit Kunststoffsandalen, in denen sie elendiglich über den Boden
schlurfen. In der Vitrine der Theke liegt ein Standventilator. Darüber
befindet sich ein Behälter mit Mandazi, krapfenartige Gebilde, die
zum Frühstück immer frisch in Öl herausgebacken werden.
Ein Radio wird in Betrieb genommen. Im Regal hinter der Theke gibt es
modernst verpackten Juice, Tee, cooking fat und eine Flasche mit flüssigem
Butterschmalz, das offenbar hier hergestellt wird.
Abend. Spazieren durch den Ort auf der Suche nach angekommenen Lastwagen
und der Möglichkeit, in einer Fahrerkabine die Weiterfahrt nach Wajir
erleben zu dürfen. Ein Tankwagenzug hat bloss einen Platz frei, ein
zweiter LKW ist voll, ein weiterer will uns offenbar nicht mitnehmen.
Wir gehen noch zu einer Lodge, die nicht an der Hauptstrasse liegt sondern
nahe den Markthütten zum Wadi hin, und von wo laute Musik vom Wind
verweht wird. Im Finsteren streite ich mit einem Beifahrer herum, der
uns dann doch zum Fahrer bringt. Der sitzt mit seinen Kollegen auf einem
Stahlrohrbett und ist mit der Hauptbeschäftigung dieses Landstrichs
befasst, dem Kauen von Mirá. Die ganze Partie im Dunklen, der Hof
der Lodge ausgeleuchtet vom nahenden Vollmond. Der wichtige Beifahrer
dolmetscht. Es wird uns versichert, dass wir für KSh 60,00 pro Person
Plätze in der Fahrerkabine haben können. Vor der Lodge stehen
zwei LKW, ein Toyota mit Schnauze und ein Mitsubishi Fuso ohne. Ich frage:
Which one is it? Die Antwort: The big one.













Donnerstag 11 Juni
Warten bereits am frühen Morgen vor den Fahrzeugen. Wir wissen nicht
einmal, wie der Fahrer aussieht, weil es gestern schon so dunkel war.
Die Besatzung schläft noch unterm Auto. Der Fahrer steht als letzter
auf. Der andere LKW wird bereits geschmiert und geputzt, die Motorhaube
geöffnet und wieder zugemacht. Dies ist nicht einfach, denn dieselbe
wird durch Vorhangschlösser, Absperringe, Ketten und Stricke verschlossen
gehalten. Der Motor wird lange vor der Abfahrt laufen gelassen. Wir dürfen
uns schliesslich in der Kabine in die zweite Reihe verziehen. Es ist nicht
das, was wir uns vorgestellt haben aber auch nicht völlig unbequem.
Neben dem Fahrer finden dann noch drei Personen Platz. Ein junger Mann,
der wegen einer Behandlung seiner kidneys bei einem Arzt in Nairobi war
und dafür angeblich KSh 3000,00 bezahlt hat. Er ist in form four
oder five und will später auf die Universität gehen. Ein anderer
ist mit einer Tarnjacke bekleidet und besucht bei jeder police barriere,
diesmal etwa ein halbes Dutzend, seine Kollegen am nagelgespickten Eisenträger.
Während der Fahrt versucht er Franziska aufzuheitern. Sie will den
Turban nicht aufbehalten, den wir ihr zum Schutz vor dem Fahrtwind um
den Kopf gewickelt haben. Zwischendurch schläft sie vor Erschöpfung
ein oder strampelt und vollführt die tollsten Verrenkungen, hustet
und klagt. Dann ist da noch ein junger Beifahrer, der aber im Lauf der
Fahrt dem ChefBeifahrer, dem Dolmetscher von gestern, Platz machen muss.
Der Fahrer kaut ununterbrochen Mirá und nimmt ab und zu einen Schluck
aus einer Sprite Flasche. Immer wieder treibt er Spässe mit den anderen
LKW Fahrern. Abwechselnde Überholmanöver, Parallelfahren und
wenn die weit auseinanderliegenden Fahrspuren wieder auf eine Spur zusammenlaufen,
den anderen Fahrer schneiden oder geschnitten werden und hinterher fahren
in einer Staubwolke. Weiters, rasen auf waschbrettartigen PistenAbschnitten,
sodass das Fahrzeug unweigerlich in die Bestandteile zerfällt. Es
empfiehlt sich, den Mund zuzumachen, weil die Wangen sonst flattern. Der
Beifahrer darf zwar nicht fahren, dafür umso mehr Mirá kauen.
Sein Gesichtsausdruck wird immer düsterer. Der Fahrer bleibt von
Zeit zu Zeit stehen. Ein Mann der crew in frischgewaschenen blue jeans,
dunkelblauem, samtenen T-shirt und Westernstiefel, springt vom Wagen herunter,
rekrutiert einen Vorschlaghammer und schlägt auf die Federblätter
der Hinterräder, die ihre Verankerung verlassen haben. Zweimal sind
sie bereits so weit gewandert, dass das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben
werden muss, um sie wieder an den ursprünglichen Ort zurückschlagen
zu können. Die Federblätter werden mit Hanfseilen zusammengeschnürt.
Offenbar fehlt ein Bolzen oder ein Widerlager oder ähnliches.
In Wajir taumeln wir in die
Camel Lodge. Frage den jungen Mann, der die Zimmer vergibt, nach einer
Bank. Es gibt keine. Er sagt, Geldwechseln ist im office des D.C. möglich.
He can help. Suchen dann zu einem ungünstiger Zeitpunkt ein Lokal
auf, um etwas zu essen. Im Gespräch mit einem anderen Gast erfahren
wir, dass es möglich ist, in Geschäften zu wechseln. Wir betreten
eines, wholesalers, werden weitergeleitet und schliesslich dahingehend
belehrt, dass es verboten ist zu wechseln. Wir gehen zum Markt, wo wir
mit einer Frau aus Italien und ihrem Fahrer ins Gespräch kommen.
Sie ist bereits neun Jahre hier und arbeitet mit behinderten Kindern.
Ein wenig später hält ein luxuriöses 4WD Fahrzeug, ebenfalls
mit einer Frau aus Italien und zwei Männern aus Malta. Catholic Mission.
Sie laden uns ein, Morgen zu Mittag zu ihnen zu kommen. Sie helfen uns
mit einem Vorschuss aus. Kaufen uns davon gleich ein paar Mangos. Die
Fruchtsäure ist sehr stark und verbrennt einen den Mund.
Die Camel Lodge ist weit nicht so romantisch wie die Unterkunft in Modo
Gashe. Statt Petroleumlampe und Holzfeuer haben wir Neon Licht und eine
zerschnittene Mineralöltonne, in der Abfall glost. Die Unterkunft
verfügt über einen kleinen Innenhof, in dessen Mitte sich ein
mit Wellblech überdachtes Rondeau befindet. Am Nachmittag liegt das
Ensemble im Dornröschenschlaf, am Abend kommt es in Bewegung. Sämtliche
Zimmer sind vergeben. Im ersten Stock gibt es eine Art Schlafsaal. Ein
Vorteil ist, dass die abendliche Brise dort besser ankommt. In den Hof
kann man die Betten wegen des Neonlichts nicht stellen.
Heide ist im Zimmer. Das Mauerwerk ist von Zwischenräumen durchbrochen,
damit die Brise durchziehen kann. Von der Strasse sind Kinderstimmen zu
hören. Im Innenhof Geräusche von Zimmertüren, Schritte,
Stimmen. Mit Freude bemerken wir das Auffrischen der abendlichen Brise.
Ein junger Mann spricht mich an und stellt die üblichen Fragen. Where
do you come from? Where do you go? Is it your first time? etc
Ich schreibe auf einem gemauerten Sims. Tisch gibt es keinen. Der TintenStift
ist bloss noch sechs Zentimeter lang. Mosquitos schwirren herum. Heute
auch Mirá gekauft, jedoch schlechte Qualität. Bloss verholzte
Zweigenden.
Freitag 12 Juni
Besuchen australische Missionare und die Catholic Mission. Was besonderes
ist weder das eine noch das andere.
Abend in der Camel Lodge. Ein Radio ist in Betrieb. Im Rondeau sitzen
einige Männer und unterhalten sich. Heute sind nicht so viele Gäste
wie gestern.

Samstag 13 Juni
Frühstück im Central Hotel mit Ausblick auf unsere Herberge.
Sitzen im Freien und die Fliegen erfreuen uns. Uji, MaisPorridge, steht
auf der Speisekarte, allein es ist nicht vorhanden. Der Chai ist so süss,
dass wir ihn nicht trinken können. Bestehen üblicherweise auf
ungezuckerten Tee, aber die Köchin mit dem schillernden Kleid ist
mit dem Backen der Mandazi beschäftigt und kann uns jetzt nicht extra
ungesüssten Tee machen. Dutzende handliche Germteiggupfe lagern schon
griffbereit, diese werden ausgerollt und der Fladen durchschnitten, diagonal.
Die Dreiecke werden dann ins heisse Butterschmalz über Holzkohlenfeuer
gelegt und bruzzeln dort bis sie goldbraun glänzen.
Sonntag 14 Juni
Versuchen am Morgen eine Mitfahrgelegenheit in einem LKW zu finden. Die
Fahrer sind ziemlich unfreundlich, warum weiss ich nicht. Gehen daraufhin
zur Abfahrtstelle des Garissa Express, wo das Gedränge bereits ein
Ende findet. Der Bus ist voll. Heide versucht noch dieses und jenes, eine
Lehrerin, die in Ramu tätig ist, hilft ihr. Schlieslich aber gehen
wir wieder zurück in die Camel Lodge. Auf unserer Zimmertür
steht keine Nummer sondern Wajir. Links davon befindet sich das Zimmer
Mandera, rechts davon Garissa. Wir hätten vielleicht das Zimmer entsprechend
unserer Route mieten sollen. Franziska schläft. Heide legt sich auch
ein wenig nieder. Aus anfänglichem Unwohlsein wird bald Übelkeit.
Ich kaufe noch Maisgriess und schwarzen Tee und schicke jemanden um Holzkohle.
Als das Maisporridge fertig ist, kann sie es aber nicht mehr essen. Mittlerweile
hat sie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost. Mit einem
Wort: Malaria. Ich laufe zu den australischen Missionaren und ersuche
um Hilfe. Anne und Jeanne begleiten mich. Da Heide nicht mehr gehen kann,
organisieren sie ein Auto und bringen sie zu ihnen nach Hause.
Montag 15 Juni
Heides Fieber ist auf Grund der Einnahme von Chlorchinin zurückgegangen.
Ziemlich geschwächt liegt sie jedoch darnieder.
Bei den Missionaren herrscht Betriebsamkeit. Eine Frau wäscht die
Wäsche, zwei weitere sind mit Haushalt und Abwasch beschäftigt.
Ein älterer Mann bringt Wasser vom Brunnen. Westliche Musik rieselt
aus dem Radio. Der kleine John weint. Er ist ins Freie gelaufen und gestolpert.
Es bläst eine ordentliche Brise, leider nicht ununterbrochen, sodass
die Fliegen immer wieder eine Gelegenheit finden, sich auf Mund, Nase
oder in die Augenwinkel zu setzen. Fanziska sitzt inmitten einer Kinderschar.
Sie ist immer noch verschnupft, hustet, schwitzt und ist von Mosquitos
zerstochen. Verabreiche ihr einen Teelöffel Nivaquine Syrup, grauenhaft
schmeckendes Zeug in kräftiger Farbe. In 5ml sind 68mg Chlorchininsulfat
enthalten. Am Vormittag noch lege ich sie zu Heide in das knarrende Bett.
In der Nähe verliert sich gerade dröhnend ein Traktor. Es regnet
ein wenig. Der Himmel ist immer wieder voll mit schwarzen Wolken, aber
regnen will es nicht. Die paar Tropfen haben den roten Staub dieses Bodens
gerade einmal ein wenig angefeuchtet, sodass dieser typische Geruch nach
angefeuchtetem Staub entsteht.
Die Sonne scheint auf die Oase
Wajir. Warum es hier Malaria gibt, leuchtet ein. Liegt wohl an den Toiletten.
Bei jedem Haus gibt es etwas abgelegen einen kleinen Kubus. Darin befindet
sich die Toilette. Die Häuser sind von einer weitläufigen Mauer
umgeben. Meist ist der ToilettenKubus in die Mauer eingebunden. In dem
Kubus scheisst man in einen Kübel, der von ausserhalb der Mauer herausgenommen
wird. Was damit geschieht, weiss ich nicht. Jedenfalls stinken diese Kuben
gegen den Wind und der trägt den Duft durch die engen Gassen. Warum
sie den Kübelinhalt nicht kompostieren ist, weil sie nichts aber
auch schon gar nichts mit Gartenwirtschaft zu tun haben. Alle Produkte
die es hier gibt werden mit LKW herangekarrt. Weil alle ihre Brunnen in
der Nähe ihrer grauslichen Häusln haben, dürfen anscheinend
keine tiefen Gruben gegraben werden. Wegen der Grundwasserverunreinigung.
Die meisten Brunnen sind etwa 10 Meter tief. Bei unseren Gastgebern trinken
wir Regenwasser, welches in ehemaligen Mineralölfässern lagert.
Die Hitze ist enorm.
Dienstag 16 Juni
Mittwoch 17 Juni
Bereits am frühen Morgen ist das Horn des Busses zu hören. Es
ist noch finster, der Cassettenrekorder schreit schon vom Minarett, dazwischen
tönt das Signal des Busses: di-re dam dam, da-ra di-re dam dam. Auf
und ab, immer wieder. Geschäft und Religion im gemeinsamen Konzert.
Ich eile zum Bus und erfrage den conductor, der mir empfielt zu warten
und daraufhin verschwindet. Er holt mich schliesslich in ein Restaurant,
kramt einen Zettel hervor und verlangt das Fahrgeld. Wir wollen nur nach
El Wak, die halbe Strecke nach Mandera, das scheint uns schon anstrengend
genug. Bis El Wak will er aber keine Sitzplätze vergeben.
Es empfielt sich, eine halbe bis dreiviertel Stunde vor Abfahrt bereits
in den Bus einzusteigen. Alle Passagiere versuchen möglichst viel
ihres wertvollen Gepäcks im Inneren des Busses unterzubringen.
Ein herkömmlicher europäischer Bus, völlig ausgeräumt
und ohne Boden könnte einem hiesigen Bus leicht als Garage dienen.
Derart geräumig, ist es Konstrukteuren vor Ort gelungen, anstelle
der Reihen mit zwei Sitzen zu beiden Seiten des Mittelganges auf einer
Seite sogar eine Reihe mit drei Sitzen einzubauen. Der Abstand zum Vordersitz
ist so bemessen, dass er auch in einem school bus schwerlich zur Anwendung
käme.
Das Buspersonal setzt sich aus vier Personen zusammen. Neben dem Fahrer
gibt es den conductor und seinen Vorgesetzten. Der erste ist ein kleiner
schmächtiger Schreibertyp mit guten Englisch Kenntnissen. Der andere,
der Kassier, ein schwerer Koloss von arabischer Herkunft. Der vierte ist
mit dem Verstauen der Gepäckstücke betraut, dazu kommen noch
Wartungsarbeiten am Bus. Die anderen drei rühren keinen Finger diesbezüglich.
Derart eingezwängt, die Kniescheiben an die Hartholzplatte des Vordersitzes
gepresst, setzt sich der Bus in Bewegung und fährt ab. Erwartungsgemäss
nur bis zur Tankstelle. Nach einiger Zeit geht es wieder weiter. Diesmal
bis zur police barrier. Anfangs stehen nur wenige Passagiere, das heisst
der Mittelgang ist voll. Zweimal kämpfen sich der Schreiber und der
Koloss durch zum Zwecke der Ticketkontrolle. Eine Frau sitzt am falschen
Platz und das im vollen Bus. In eine Liste, die offenbar beim Fahrer aufliegt,
wird Einsicht genommen. Der conductor kommt erneut, gefolgt vom Koloss.
Wieder Ticket Besichtigung. Auch wir sitzen falsch. Unsere Sitze haben
die Nummern 26 und 28. Unsere Tickets aber 21 und 23. Doch auch die Passagiere
vor uns sitzen auf falschen Plätzen, sodass es egal ist. Eine Frau
jedoch muss ihren Platz verlassen und eine andere setzt sich hin. Die
Tickets selbst sind ganz kleine, dünne Zettelchen. Sie tragen diverse
Vermerke: tickets not refundable. Passenger luggage carried at owner's
risk.
Neben mir der Fenstersitz, auf der anderen Seite der Mittelgang. Ständig
versucht ein Stehplatz Passagier den Raum über meinem Sitz oder Teile
der Rückenlehne zu erobern.
Halte das Kind Franziska fest. Sie liegt meistens erschöpft schlafend
darnieder. Bin permanent damit beschäftigt, unvorhersehbare Stöße
des Fahrzeuges und der sich im Mittelgang befindlichen, sich irgendwie
festhaltenden Passagiere abzuwehren. Weiters das schlafende und schwitzende
Kind von Fahrtwind und Zugluft zu schützen. Aus dem Bordlautsprecher
tönt laut und verzerrt Bob Marley: No woman no cry, I shot the sheriff,
Get up stand up etc. Die Cassette wird sobald sie zu Ende ist umgedreht
und erneut abgespielt. Die gesamte Cassette etwa viermal hintereinander.
Auch gut ausgerüstete Reggae Fans überleben das nicht.
Am Vormittag bleibt der Bus
in einem kleinen Ort stehen Es gibt Chai und etwas zu essen. Weiter fährt
der Bus durch endlose Ebene, vorbei an Büschen und Bäumen, dann
und wann Kamele, Rinderherden oder Ziegen in grösserer Anzahl.
In El Wak sind wir schon völlig erschöpft, können aber
gar nicht aussteigen, weil sich dort der Bus erst richtig füllt.
Der Mittelgang, ohnehin so schmal, dass man nur mit Mühe an jemandem
vorbeikommt, wird mithilfe des Gepäckbeauftragten und mitfahrender
Soldaten, zwei mit automatischen Gewehren ausgerüstete Uniformierte,
derart aufgefüllt, dass zwei Personen nebeneinader zu stehen kommen.
Die Einheimischen sind zwar alle schlank, aber das geht nur, wenn jeder
in den Raum über einer Sitzlehne ausweicht und sich irgendwie festhält.
Bei einem Stop quälen sich die Aussteigenden durch und sofort strömen
neue Passagiere herein. Ein Verlassen des Käfigs ist spätestens
dann nicht mehr möglich.
Der Gedanke an einen Unfall oder Brand bietet keine tröstliche Perspektive.
Der Bus hat hinten keine Tür. Die Fenster sind klein und derart konstruiert,
dass in Augenhöhe eine massive Verstrebung durchgeht, die den Blick
auf den Horizont verwehrt. Bloss ein paar Meter Fahrbahn neben dem Bus
sind ohne Mühe einzusehen. Oberhalb der Verstrebung nur Himmel. Im
Notfall durch den schmalen Fensterschlitz zu entkommen ist illusorisch.
Aufgrund der Stops und Gepäckverstauung summiert sich eine Stehzeit,
dieselbe versucht der Fahrer durch unvorstellbare Raserei zu kompensieren.
Der Bus ist auch völlig überladen. Kurz vor Mandera steigt die
Piste einmal an. Garissa Express vermag sich bloss im Schneckentempo noch
vorwärts zu bewegen. Der Motor heult, ich befürchte den Brand
des Motors.
Die Fahrt dauert inclusive der vielen undurchschaubaren Stops von 07:30
bis 18:00 Uhr. Zum Glück ist hier jetzt Winter sonst wären wir
in der Büchse verschmort.
Anspruch auf einen Sitzplatz erhält, wer früh genug bucht. Der
Bus Garissa Express fährt sehr bald am Morgen in Nairobi ab und erreicht
über Garissa bei Einbruch der Dunkelheit Wajir. Eine kaum vorstellbar
abgründige Fahrt, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir bereits
drei volle Tage unterwegs sind, um nach Wajir zu gelangen. Reine Fahrzeit
wohlgemerkt, die Tage der Regeneration nicht eingerechnet.
Von weitem schon ist das Horn des Busses zu hören. Sodann staubt
er heran in Herrlichkeit und hält. Die Passagiere fallen heraus und
taumeln, ihre Taschen fest in Händen, in eine Lodge oder zu Verwandten
und Freunden.
Donnerstag 18 Juni
Eine leichte Brise bewegt die gespannte Wäscheleine mit zwei Handtüchern
zwischen zwei Bäumen. Auch hier eine nicht endende Ebene. Das Mandera
Rest House liegt auf einer kleinen Anhöhe, der Ort selbst in der
Ebene. Blicke nach Westen in das Landesinnere von Kenya oder Äthiopien.
Ebene. Ein Problem am rechten Fuß. Der ist offen. Lymphknoten in
der Leiste sind schon angeschwollen. Im Hospital hat man mir Canesten
gegeben.
Verliere meinen Tintenblei im
Zug der Vorbereitungen einer nachmittäglichen Siesta. Ausgerüstet
mit einer Plane und Leintuch suche ich im weitläufigen Areal um unsere
Unterkunft eine grosse Akazie aus, darin die Vögel nisten und schlafe
beinahe komfortabel ein. Franziska ist bei mir, hält aber nichts
von dem Amgebot. Zwei Militärtransporter steigen nach längerem
Warmlaufen langsam in den Himmel auf. Es ist unheimlich warm, obwohl der
Himmel bedeckt ist. Im Zimmer 30°C. Der Wind weht sanft, unsichtbare
Kreaturen piesaken mich unter der Akazie, sodass wir wieder in den Raum
Nr. 6 gehen, der auch mit Kalaliyo überschriftet ist. In der Folge
liege ich dort im Bett und harre eines Fieberanfalles. Die Fliegen nützen
meine Schwäche aus, der Puls jagt, der Kopf ist heiss. Feuchte Umschläge
und Belladonna Globuli werden wohl nicht viel nützen.
Freitag 19 Juni
Franziska ist nicht bei bester Laune, derweil ihre Mama auf dem Weg zu
Esther de Luka ist, einer Lehrerin aus Canada. Sitze auf dem Bett auf
einer Schaumgummimatratze. Dieses Produkt wird hier mit grosser Akribie
verteilt, ist aber ungefähr das letzte, worauf freiwillig ich hier
liegen will. Ein einfaches Holzbrett, wenn irgendwie erhältlich,
ist vergleichsweise ideal dagegen. Das Bett befindet sich in dem grosszügig
angelegten Mandera City Council Rest House, MCC-RH abgekürzt auf
den Rückenlehnen der schweren Sitzmöbel. Franziska jammert mit
grosser Ausdauer und befindet sich bereits in einem Stadium der Entrücktheit.
Mandera ist eine Grenzstadt im Nordosten von Kenya, wo Äthiopien
und Somalia angrenzen.
Samstag 20 Juni
Heidi und Franziska gehen mit Esther de Luka und ihrer Tochter Jennifer
zum Markt. Ich fange im Zimmer etwa hundert Fliegen und befördere
sie vom Leben in den Tod. Dann lege ich mich auf das Bett und döse
vor mich hin. In der Nähe blökt ein Schaf ganz erbärmlich.
Auch die Esel schreien ständig. Die Brise frischt etwas auf.
Sonntag 21 Juni
Lagern in der Markthalle von Mandera und versuchen Sachen loszuwerden,
die wir schon hunderte Kilometer über Land transportieren und heilfroh
sind, wenn sie uns endlich verlassen. Die Einheimischen aber wollen kein
Geld ausgeben. Für ein Handtuch keine 10 KSh, das sind 60 SomaliSh
und 8 österreichische Schilling. Was haben wir noch. Unterhemdchen
von Franziska, ein weisses Kleid, ein Pullover und eine Jacke. Von Heide
ein indisches Hemd und ein Gilet, ein sehr solides Hemd von mir, es würde
einen Wintereinbruch in diesem Landstrich voraussetzen. Ein kurze Hose,
nicht von der kommoden Art sondern der militärisch unverwüstlichen.
Wiegt garantiert mehr als ein halbes Kilo. Zwei Strumpfhosen von Franziska,
die hier auch niemand braucht. Jedesmal wenn ich die Sachen wieder in
den Rucksack stopfe, greife ich mir an den Kopf.
Eine Menge Kinder stehen um uns herum, bis zu vierzig. Wenn nicht ab und
zu jemand sie verjagt, wurzeln sie noch an. Schade dass es hier keine
TV Apparate gibt, in die diese Kindermassen hineinschauen können.
Gemein.
Das grösste Interesse erregen Heides Sportschuhe. Ein Interessent
probiert sie sogar, nicht ohne sich vorher ein Nylonsackerl über
den Fuss zu stülpen. Ich denke an meinen lädierten Fuss und
die angeschwollenen Lymphknoten in der Leiste.
Die meisten Kindersachen gehen um den Preis einer Grapefruit weg. Das
sind 20 Somali Shilling oder 2 ATS.
Ein Tuch wie man es sich hier traditionell um den Leib wickelt, kostet
820,00 Sh, etwa 80,00 ATS, ein japanisches Radio mit Cassettenrecorder
9800,00 Sh. Es gibt mehrere Buden, in denen diese Geräte, in Kunststoff
verpackt, angeboten werden. Jeans gibt es ausreichend, diese Art der Bekleidung
ist aber aufgrund der Hitze denkbar ungünstig.
Rund um die Markthalle sind Buden aus Ästen errichtet, mit Jutefetzen
oder Kunststoff bespannt oder Karton darauf befestigt. Dort werden bunte
Tücher angeboten. Eine Frau benötigt mindestens vier. Um die
Hüfte, um die Schulter, den Kopf und um ein Baby zu tragen.
Die Frauen in der Markthalle sitzen am Boden und haben ein Häufchen
Reis vor sich aufgeschüttet. Eine leere Konservendose wird als Maß
benutzt. Sie verkaufen auch Santa Lucia Spaghetti und Miniatur Dosen mit
konzentriertem Sugo. Es gibt abenteuerlich anzusehende Bohnen, kohlrabenschwarze,
rote, schmutzigfarbene. Daneben graues, batziges Salz in Kunststoffsackerln,
brauner Zucker, der so langsam rieselt, als ob kleine Lebewesen herumkriechen
würden. Öl in Flaschen, etwas Knoblauch und Zwiebel. Lampen
Petroleum.
Später im Rest House. In einem PKW kommen einige Gäste an. Ein
LKW fährt beinahe bis in eines der Zimmer. Einige Herren in blue
jeans oder Freizeitkleidung fallen heraus und gehen Henderl essen. Den
Motor des LKW lassen sie laufen. Auf meine Anfrage, ob denn der Motor
nicht abgestellt werden könne, sagt einer, sie wären schon fertig
und ready to take off. Im übrigen müssten sie sonst das Fahrzeug
anschieben. Die prognostizierten fünf Minuten dauern etwa eine halbe
Stunde. Alsdann rollt ein Landrover Wrack mit aufheulendem Motor bis nahe
an den Türstock eines Zimmers. Der Motor wird nicht abgestellt sondern
einige male derart aufheulen lassen, dass die Auspuffgase auch noch Staub
aufwirbeln.


Montag 22 Juni
Die Sonne steht schon über dem Wasserturm. Eingespannte Esel traben
vorbei, die Wasserbehälter scheppern. Ein Radio ist eingeschaltet.
Andere Rest House Gäste kramen in ihrem PKW herum. Immer zuerst aufsperren
dann wieder abschliessen. Bei vier Insassen kommt einiger Schlüsselverschleiss
zustande. Fliegen versuchen unser Zimmer zu okkupieren. Das von seinen
Freunden getrennte, hinter unserem Zimmer angebundene Schaf blökt
traurig bis wütend vor sich hin.
Spazieren in den Ort und erkundigen uns nach der Strasse zur Grenze und
den Grenzgebäuden. Treffen uns mit Richard, der im office des DC
Soldat ist, zu einem Tee und Mandazis. Besuchen die Apotheke. Der angenehmste
Raum weit und breit. Zwei Ventilatoren an der Decke. Die Medikamente in
einem gekühlten Raum.
